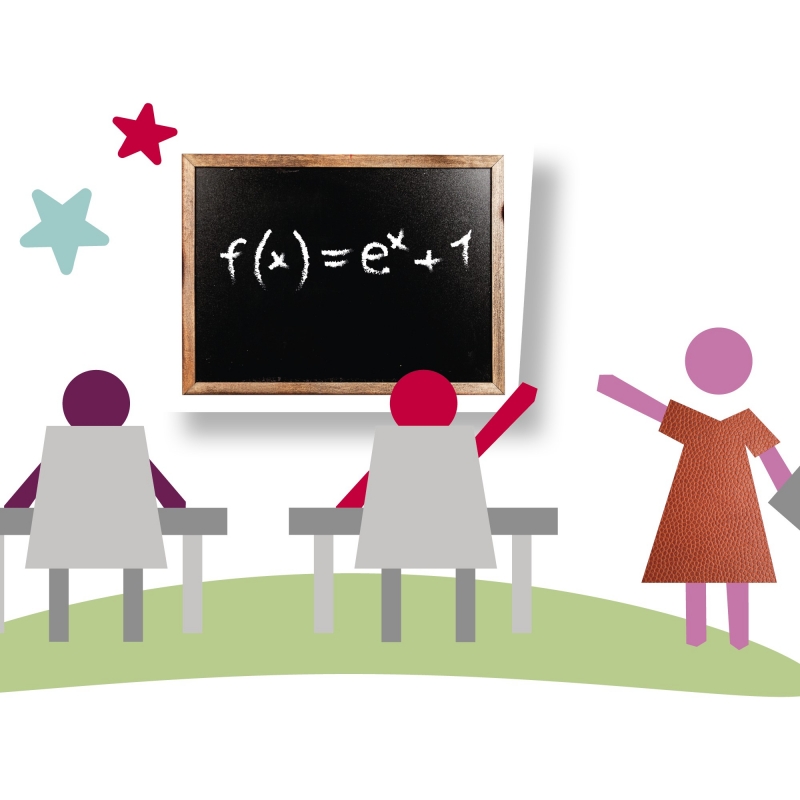Hochbegabte unterstützen
Externalisierendes und internalisierendes Verhalten
Bei der psychologischen Betrachtung von Verhaltensweisen wird oft internalisierendes von externalisierendem Verhalten unterschieden 2. Externalisierende Verhaltensweisen (z. B. Unterrichtsstörungen, Hyperaktivität, Aggressivität, oppositionelles Verhalten, Mobbing) richten sich vor allem nach außen und beeinträchtigen daher in erster Linie das soziale Umfeld der Kinder und Jugendlichen. Unter den darauffolgenden ablehnenden Reaktionen ihrer Mitmenschen, sowie unangenehmen Gefühlen wie Scham, Wut und Enttäuschung, leiden jedoch ebenfalls die Betroffenen. Internalisierende Verhaltensweisen (z. B. sozialer Rückzug, psychosomatische Beschwerden, Ängstlichkeit, Depressivität) beschreiben ein nach innen, also vorrangig gegen die eigene Person gerichtetes Verhalten. Da Schweigen, sozialer Rückzug oder Bauchschmerzen weniger gut von außen beobachtbar und z. B. für pädagogisches Fachpersonal weniger störend als externalisierendes Verhalten sind, wird eine mögliche Notlage dieser Kinder seltener entdeckt, wobei der Leidensdruck für die betroffenen Kinder und Jugendlichen ebenfalls beträchtlich sein kann 3.
(Hoch-)Begabte haben kein höheres Risiko für soziale und/oder emotionale Probleme
Bei (hoch-)begabten Kindern und Jugendlichen wurde untersucht, ob ein besonders hohes Risiko für soziale und emotionale Probleme im Vergleich zu durchschnittlich intelligenten, vergleichbaren Kindern und Jugendlichen vorliegt. Aktuell gibt es dazu unterschiedliche Befunde, sodass man davon ausgehen kann, dass (Hoch-)Begabte weder mehr noch weniger anfällig für Verhaltensauffälligkeiten und sozial-emotionale Probleme sind 4. Anzunehmen ist, dass es (hoch-)begabungsspezifische Risikofaktoren (z. B. Perfektionismus, asynchrone Entwicklung) gibt und die Bedürfnislage (Hoch-)Begabter nicht komplizierter, sondern anders ausgestaltet sein kann als die durchschnittlich begabter Kinder und Jugendlicher 5. Viele (Hoch-)Begabte zeichnen sich durch eine schnelle Informationsaufnahme, schnelles Lernen, ein gutes Gedächtnis, eine hervorragende Beobachtungsgabe, viel Energie und vielfältige Interessen aus. In bestimmten Kontexten können einige dieser Stärken von anderen Menschen als unangenehm oder lästig wahrgenommen oder negativ interpretiert werden (z. B. als Ungeduld, störende und sinnlose Fragen, Widerwille gegen Anweisungen, Dominanz). Dies kann auch bei den (Hoch-)Begabten selbst zu Frustration führen (z. B. Langeweile, Ruhelosigkeit, Gefühl des Nicht-verstanden-Werdens und des Anders-Seins), was wiederum im zwischenmenschlichen Kontakt problematisch werden kann.
Wenn von der Norm abweichendes Verhalten und emotional-soziales Erleben nicht als Teil der (Hoch-)Begabung verstanden wird, kann dies Anlass dafür sein, warum Eltern eine (schul-)psychologische Beratungsstelle aufsuchen oder von Lehrer:innen und Erzieher:innen darauf hingewirkt wird. Nicht selten werden diese Verhaltensweisen auch von Fachkräften als Verhaltensstörung missinterpretiert und als klinische Störung fehldiagnostiziert 4. Zwei häufig genannte Anmeldegründe in der psychologischen Beratung sind soziale Isolation und aggressives Verhalten bei (hoch-)begabten Kindern und Jugendlichen.
Soziale Isolation
(Hoch-)begabte Kinder und Jugendliche sind insgesamt nicht häufiger isoliert als nicht (hoch-)begabte. Dennoch geht es bei ca. 60% der Beratungen um problematische Sozialkontakte mit Gleichaltrigen. Konkrete Themen dieser Beratungsfälle sind u. a. Unsicherheit, Streit und soziale Isolation 1.
Soziale Isolation im Kitaalter
Bereits in der Kita kann auffallen, dass (hoch-)begabte Kinder lieber allein spielen und am gemeinsamen Spiel mit Gleichaltrigen wenig Interesse zeigen. Sehr früh interessieren sie sich hingegen für Tätigkeiten wie Lesen, Rechnen und dem Erkunden und Verstehen physikalischer Zusammenhänge, womit viele durchschnittlich intelligente Kinder in diesem Alter noch nicht viel anfangen können. Ihre Stärken, wie eine schnelle Auffassungsgabe, hohe Ansprüche an sich selbst und andere, können es (hoch-)begabten Kindern schwer machen geeignete Spielpartner und Freunde zu finden. Für (Hoch-)Begabte ist es oft schwer nachvollziehbar, dass andere Kinder Informationen nicht so schnell aufnehmen und behalten können, wie sie selbst, weshalb sie ungeduldig oder intolerant auf andere wirken können 6. Da viele (hoch-)begabte Kinder Aufgaben lieber selbstständig bearbeiten, lehnen sie Hilfestellungen und Anregungen von Gleichaltrigen öfter ab. Das starke Bedürfnis nach Unabhängigkeit kann auch als Desinteresse interpretiert werden.
Soziale Isolation im Schulalter
Wenn (hoch-)begabte Kinder bereits in der Kita unter wenig geeigneten oder keinen Sozialkontakten leiden, kann dies dazu führen, dass sie sich sozial isoliert fühlen. Bei fehlender Unterstützung kann sich dies in der Grundschule fortsetzen. Mit guten Leistungen in der Grundschule sind (hoch-)begabte Kinder oft Vorbild für die anderen Grundschulkinder und bei diesen beliebt. Dennoch kann es vorkommen, dass sie nur wenig Kontakt mit Klassenkamerad:innen pflegen und keine Freund:innen außerhalb der Schule haben. Auf der weiterführenden Schule kann es häufiger vorkommen, dass Klassenkamerad:innen auf gute Noten oder die Beliebtheit bei Lehrer:innen eifersüchtig sind und (hoch-)begabte Kinder und Jugendliche gemieden oder ausgegrenzt werden. Viele der betroffenen (hoch-)begabten Kinder und Jugendlichen leiden stark unter ihrer Isolation und reagieren sehr sensibel und mit starker Intensität auf soziale Ausgrenzung.
Einige (Hoch-)Begabte wissen nicht genau, wie sie auf andere Menschen zugehen sollen. Es kann ihnen schwerfallen, ihre eigenen Gefühle zu verstehen und sich Gleichaltrigen und Erwachsenen mitzuteilen. Durch Ablehnung und Isolation kann auch das Gefühl entstehen „nicht richtig“ zu sein. Viele (Hoch-)Begabte, insbesondere Mädchen, versuchen daher, sich anzupassen und verstecken ihre Begabung. So kann auch ein negatives Selbstbild der eigenen Begabung und Persönlichkeit entstehen.
Aggressives Verhalten
Das Thema Aggressivität ist in der Beratung von (hoch-)begabten Kindern und Jugendlichen genauso vertreten wie in der allgemeinen Erziehungsberatung. Ca. 45% der Eltern geben an, dass ihr (hoch-)begabtes Kind aggressive Verhaltensweisen zeige, welches bei einem Teil der Familien auch zu sehr starken Belastung beitrage 7.
Wie sich aggressives Verhalten zeigt
Ein (hoch-)begabtes Kind kann in der Schule positiv durch seine guten Beiträge und gleichzeitig negativ durch aggressives Verhalten auffallen. Besonders in Gruppenarbeiten kann von der Norm abweichendes Verhalten problematisch werden und den Arbeitsprozess oder die anderen Schüler:innen stören. Manchmal werden selbstbewusstes Verhalten und Zielstrebigkeit als aggressiv fehlinterpretiert und geben Anlass für Konflikte mit Gleichaltrigen. Gleichzeitig verfügen manche (Hoch-)Begabte über eine geringe Frustrationstoleranz und werden ärgerlich, wenn etwas nicht – wie sonst – sofort funktioniert oder sich eine Aufgabe nur unter größerer Anstrengungsaufwendung lösen lässt.
Wie aggressives Verhalten entstehen kann
Viele (Hoch-)Begabte haben bereits früh eine Vorstellung davon, wie sie bestimmte Dinge angehen wollen, und können gut für sich einstehen, ihre Meinung geschickt artikulieren und differenziert argumentieren. Das dahinterstehende stabile, positive Selbstkonzept kann aber auch mit einer Häufung von Diskussionen und konflikthaften Auseinandersetzungen einhergehen. Wenn z. B. Eltern oder Lehrer:innen pauschale und verallgemeinernde, nicht begründete Anweisungen geben, kann Frustration oder Wut entstehen. (Hoch-)begabte Schüler:innen erleben alltägliche Frustrationen, wie langes Warten auf Mitschüler:innen, zu wenig Raum für spezielle, tiefergehende Fragen oder anhaltende kognitive Unterforderung. Das Modell der Spirale der Enttäuschungen beschreibt, wie solche dauerhaften und sich selbst verstärkenden Frustrationen dazu führen können, dass (Hoch-)Begabte mit externalisierendem Verhalten (z. B. Aggressivität, motorischer und verbaler Unruhe) reagieren 8. Einige (hoch-)begabte Kinder und Jugendliche befinden sich in einem Umfeld, das sie und ihre persönlichen Eigenschaften nicht ausreichend versteht oder wertschätzt. In der Schule und manchmal bereits in der Kita wird Konformität, unauffälliges Verhalten und soziale Angepasstheit erwartet und belohnt. Individualität (z. B. besonders kreative Aufgabenlösung, ungewöhnliche Kommentare und Fragen, seltene Interessen) wird z. T. hingegen leicht missverstanden, weniger gefördert und manchmal sogar unterbunden 4. Wenn (hoch-)begabte Kinder und Jugendliche den Eindruck haben, sie müssten sich anpassen und sogar verstellen, kostet sie dies viel Kraft und kann zu großer Unzufriedenheit und Enttäuschung führen. Einige (Hoch-)Begabte geraten dadurch in einen inneren Konflikt, hinterfragen sich und möchten ihr wahres Selbst nicht zeigen. Solche Identitätskonflikte, Ängste und Selbstablehnung können u. a. auch zu (selbst-)aggressivem Verhalten führen 9.
Wie können Beratende und Eltern (Hoch-)Begabte unterstützen?
Die eigene (Hoch-)Begabung als Teil der Identität anzuerkennen, ist ein andauernder Prozess, bei welchem Kinder und Jugendliche von der Unterstützung ihres sozialen Umfelds profitieren und auch von Beratenden entsprechend begleitet werden können. Ganz gleich, ob (hoch-)begabte Kinder und Jugendliche durch sozialen Rückzug oder aggressive Verhaltensweisen auffallen, als Beratende:r ist es wichtig, ihnen und ihren Eltern im Gespräch auf Augenhöhe zu begegnen und das Gefühl von echter Akzeptanz zu vermitteln. Ziel dabei ist, die vorliegende (Hoch-)Begabung nicht als Teil oder Auslöser des Problems, sondern als besondere Ressource anzuerkennen.
Deutlich Grenzen setzen bei gleichzeitiger Wertschätzung
Dazu kann es hilfreich sein, das als problematisch empfundene, z. B. aggressive Verhalten, als Lösungsversuch einer belastenden Situation zu verstehen. Aggression als grundlegende alltägliche Emotion kann auch eine positive Funktion haben, indem sie uns zur Erreichung und Setzung von Zielen motiviert und damit die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen fördern kann. Daher ist es förderlich, wenn Beratende und Eltern eine ressourcenorientierte Haltung einnehmen und die (Hoch-)Begabung als großes Potenzial, z. B. zur eigenen Lösungsfindung, verstehen. Insbesondere bei Konflikten ist es wichtig, dass Eltern in Kontakt mit ihren (hoch-)begabten Kindern bleiben und Beziehungsangebote aufrechterhalten, ihnen jedoch gleichzeitig durch klare Regeln Sicherheit und Orientierung vermitteln 10.
Interesse an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen zeigen
Ein Thema der Elternberatung kann die gemeinsame Reflexion über die mögliche Bedeutung des aggressiven Verhaltens ihres (hoch-)begabten Kindes sein. Dazu kann es hilfreich sein, genauer hinzuschauen und zu überlegen, wann das Kind wütend regiert und wann nicht 11. Wie können Eltern die Bedürfnisse ihrer (hoch-)begabten Kinder (z. B. nach Autonomie) erkennen und in angemessener Form zulassen? Beratung hat nie zum Ziel, die Persönlichkeit eines Kindes zu verändern oder nur ein unerwünschtes Verhalten zu unterdrücken. Den Familien kann es helfen, einmal die Perspektive der Kinder einzunehmen, um ihre Emotionen, Beweggründe, mögliche innere Konflikte und Bedürfnisse noch besser zu verstehen. Eltern können in der Beratung darin unterstützt werden ihre Beziehungsgestaltung zu ihren Kindern anzupassen, indem sie auf eine transparente, eindeutige, jedoch auch wertschätzende Kommunikation achten 12.
Kinder und Jugendliche in die Beratung miteinbeziehen
Auch beim Anmeldegrund der sozialen Isolation ist unbedingt die Kinderperspektive zu berücksichtigen. Es ist wichtig zu wissen, inwieweit das Kind selbst seine (relative) Isolation als Belastung empfindet. Viele (hoch-)begabte Kinder haben häufig wenige, dafür aber qualitativ hochwertige, intensive Freundschaften und sind damit auch zufrieden. Sie sollten bei der Suche nach möglichen Lösungen miteinbezogen werden. Meist wissen sie selbst am besten, z. B. welche Freizeitaktivitäten ihnen am meisten Spaß machen würden und ob weitere Hobbies eher eine Belastung oder Bereicherung für sie darstellen.
Beratende können Kinder auch beim Aufbau sozialer Kontakte unterstützen, indem sie z. B. gemeinsam erarbeiten, was ihnen in einer Freundschaft wichtig ist. Manche (Hoch-)Begabte verfügen über einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn und erwarten dies auch von ihren Freunden. Das hohe Maß an gegenseitig erwarteter Loyalität wird durch Gleichaltrige, welche noch nicht diese Stufe des Freundschaftskonzepts ausgebildet haben, oft enttäuscht. Der Idealismus der Kinder und Jugendlichen sollte in der Beratung wertgeschätzt werden, wobei auch die Thematisierung negativer Erfahrungen bei einer realistischen Einordnung der eigenen Erwartungen helfen kann. Beratende können (Hoch-)Begabte darin bestärken, dass es in Ordnung ist, wenige ausgewählte Freunde zu haben, solange sie selbst damit glücklich sind. Zu Beginn der Schulzeit ist es aufgrund der Seltenheit einer (Hoch-)Begabung unwahrscheinlicher, dass Kinder auf Gleichgesinnte treffen. Durch Selektionseffekte, z. B. die Wahl bestimmter Hobbies oder eines Studiengangs, werden sie jedoch mit der Zeit durch die geteilten Kontexte mit mehr Personen zusammentreffen, die ähnliche Begabungen, Interessen und Wertvorstellungen haben.
Sorgen der Eltern ernst nehmen und vorhandene Ressourcen stärken
Eltern können durch intensive Wutanfälle oder durch die von ihnen wahrgenommene Isolation ihrer (hoch-)begabten Kinder verunsichert werden. In Diskussionen stellen ihre schlauen Kinder die elterliche Autorität in Frage, was dazu führen kann, dass die Eltern sich schuldig fühlen und ihre erzieherischen Kompetenzen hinterfragen. Ziele der Elternberatung sind daher auch Aufbau und Reaktivierung ihrer Ressourcen sowie ein pragmatischer, lösungsorientierter Ansatz, der ihre Handlungssicherheit in Bezug auf ihre Erziehungsmethoden und Selbstwirksamkeitserfahrung stärkt 5.
Wenn Eltern mit Gefühlen der Ohnmacht und Hilflosigkeit reagieren, ist es hilfreich die eigenen Grenzen den Kindern gegenüber wertschätzend aufzuzeigen 10. Da die Reflexion und eine möglicherweise nötige Anpassung des Erziehungs- und Kommunikationsverhaltens viel Kraft kosten, können betroffene Eltern Entlastung durch die Annahme eines Beratungsangebots erlangen. Die Teilnahme an einem Gruppentraining für Eltern von (hoch-)begabten Kindern (z. B. das KLIKK®-Elterntraining kann dabei unterstützen, Handlungskompetenzen zu erweitern, Kommunikationstechniken auszuprobieren und ein lösungsorientiertes Vorgehen bei Konflikten zu etablieren 5.
Wahrnehmung und Regulation von Gefühlen
Da (hoch-)begabte Kinder und Jugendliche nicht selten die Welt zuerst auf kognitiver, sachlich-rationaler Ebene wahrnehmen und verstehen, kann es hilfreich sein, sie stärker mit ihrer Gefühlswelt in Kontakt zu bringen. Verschiedene Themen der Kinder und Jugendlichen können in der Einzelfallberatung ressourcenorientiert anhand von spielerischen Aktivitäten (Karten-/Würfelspiele, Malen, Bauen), durch Visualisierungen (Postkarten, Fotos) oder stellvertretend über Spiel-/Tierfiguren erlebbar und verbalisierbar gemacht werden. Das bewusste Wahrnehmen unterschiedlicher eigener Gefühle kann dabei unterstützen, das eigene Verhalten in bestimmten Situationen besser zu verstehen und bei Bedarf anzupassen. Gerade für (hoch-)begabte Kinder und Jugendliche ist es wichtig zu lernen, wie sie auch mit negativen Gefühlen umgehen können. Die Erfahrung, Einfluss auf ihr Verhalten nehmen zu können, ist für viele sehr entlastend. Um alternatives Verhalten in einer herausfordernden Situation zu zeigen, kann es hilfreich sein, z. B. erste körperlich spürbare Anzeichen (z. B. Herzklopfen, Schweißausbrüche), die der eigenen Wut- oder Fluchtreaktion vorangehen, zu erkennen. In der (schul-)psychologischen Beratung kann der Ausdruck und Umgang mit Gefühlen auch durch Sozialkompetenztrainings geübt werden. In einer Gruppe mit anderen Kindern können durch meist verhaltenstherapeutisch orientierte Interventionen z. B. die Kontaktaufnahme zu anderen Kindern oder ein gesundheitsförderlicherer Umgang mit Ärger und Enttäuschung, besprochen und ausprobiert werden (siehe „Weiterlesen“).
Netzwerk zur Unterstützung aktivieren
Es kann hilfreich sein, Bezugspersonen in Schule, Kita oder aus anderen Lebensbereichen, in welchen das aggressive oder zurückhaltende Verhalten der (hoch-)begabten Kinder und Jugendlichen aufgefallen ist, in Interventionen miteinzubeziehen bzw. sich mit ihnen auszutauschen. Gerade bei Übergängen (z. B. von Kita zur Grundschule oder dann zur weiterführenden Schule) ist es ratsam, einen frühzeitigen Austausch mit den Fachkräften zu initiieren, damit diese das Verhalten einordnen und bei Bedarf positiv unterstützen können. Hierbei können Beratende durch Fachwissen zur Begabungs- und Begabtenförderung, sowie durch ihre Einschätzung der Stärken des Kindes und durch eine allparteiliche Moderation ihre Klient:innen unterstützen.
Fazit und Ausblick
Beratende können Eltern durch (hoch-)begabungsspezifische Beratungserfahrung und Wissen darin unterstützen, ihre Kinder und die mit der (Hoch-)Begabung im Zusammenhang stehenden Spezifika ihres Verhaltens und Empfindens noch besser zu verstehen. Es ist hilfreich, begabungsspezifische Faktoren, die zusammen mit Umweltfaktoren und in Wechselwirkung mit diesen, auch zu Schwierigkeiten wie z. B. sozialer Isolation oder aggressivem Verhalten führen können, zu erkennen 4. So können in der Beratung passende Lösungsansätze in Bezug auf das individuelle Anliegen der Klient:innen erarbeitet und deren Umsetzung begleitet werden. Im Kontext von (Hoch-)Begabung ist neben dem Aufbau einer vertrauensvollen, beraterischen Beziehung insbesondere auf eine professionelle Auftragsklärung sowie das Vorhandensein eines gewissen Maßes an Eigenmotivation der (hoch-)begabten Kinder und Jugendlichen zu achten, damit die – am besten von ihnen selbstgewählten – Beratungsziele auch von ihnen umgesetzt werden.