Diagnostik mit Intelligenztests
IDS-2 – Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder und Jugendliche
Altersbereich: 5;0 bis 20;11 Jahre
Test-Typ: Einzeltest
Erscheinungsjahr: 2018
Verlag: Hogrefe, Göttingen
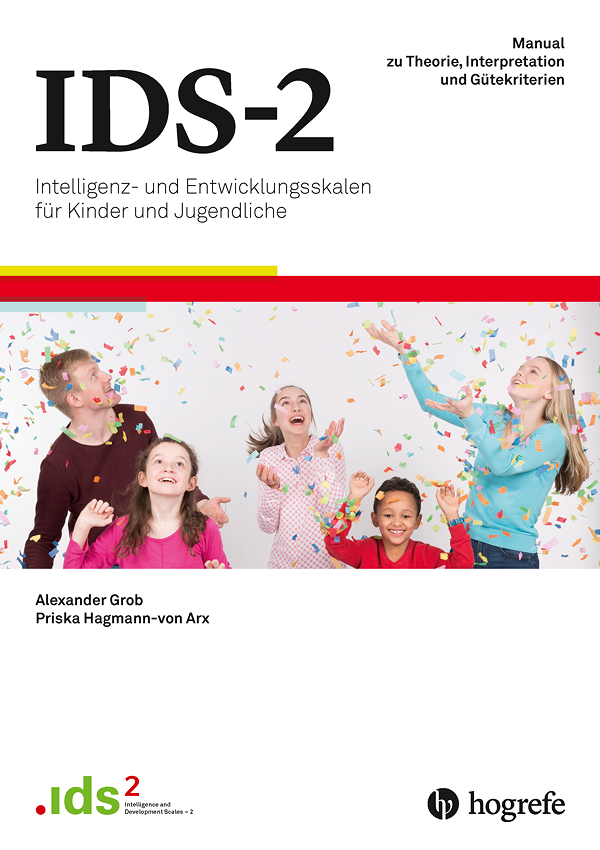
1 Beschreibung
1.1 Zielsetzung und Grundlagen
Die IDS-2 dienen der Einschätzung von kognitiven Funktionen und allgemeinen Entwicklungsfunktionen bei Kindern und Jugendlichen im Alter von fünf bis zwanzig Jahren.
Die IDS-2 basieren konzeptuell auf den IDS, erweitern deren Altersbereich und integrieren aktuelle Forschungsbefunde. Der Entwicklungsstand bei Kindern und Jugendlichen im Alter von fünf bis zwanzig Jahren wird über das Zusammenspiel von Kognition (Intelligenz und exekutive Funktionen), Psychomotorik, sozial-emotionalen und schulischen Kompetenzen sowie Arbeitshaltung abgebildet. Grundlage für die Erfassung der Intelligenz bildet die CHC-Theorie (z. B. McGrew, 2005). Die Erfassung exekutiver Funktionen stützt sich auf unterschiedliche Forschungsbefunde und Theorien zu Inhibition, Arbeitsgedächtnis und kognitiver Flexibilität. Auch die jeweilige Erfassung von Psychomotorik, sozial-emotionalen und schulischen Kompetenzen und Arbeitshaltung stützt sich auf unterschiedliche Theoriebestände unter Berücksichtigung neuerer Forschungsbefunde.
1.2 Aufbau
- Insgesamt 30 Subtests, von denen 23 für alle und 7 nur für bestimmte Altersgruppen genutzt werden können.
- Kognitive Funktionen: Intelligenz mit 14 Subtests, von denen jeweils zwei einem der folgenden 7 Intelligenzfaktoren zugeordnet sind: (1) Verarbeitung visuell, (2) Langzeitgedächtnis, (3) Verarbeitungsgeschwindigkeit, (4) Kurzzeitgedächtnis auditiv, (5) Kurzzeitgedächtnis räumlich-visuell, (6) Denken abstrakt, (7) Denken verbal; Exekutive Funktionen mit 4 Subtests.
- Intelligenz kann über Auswahl der Subtests in unterschiedlichen Intelligenzwerten abgebildet werden: IQ-Screening (2 Subtests), IQ (7 Subtests; je einer pro Intelligenzfaktor; nur allgemeine Intelligenz), IQ-Profil (alle 14 Subtests; allgemeine Intelligenz und 7 Intelligenzfaktoren).
- Allgemeine Entwicklungsfunktionen: Psychomotorik mit 3 Subtests, Sozial-emotionale Kompetenz mit 3 Subtests, Schulische Kompetenzen mit 4 Subtests, Arbeitshaltung mit 2 Subtests.
- Durchführung des Gesamttests oder ausgewählter Module möglich.
- Es existiert kein Paralleltest.
1.3 Quellen
Grob, A. & Hagmann-von Arx, P. (2018). IDS-2. Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder und Jugendliche. Göttingen: Hogrefe.
2 Anwendung
2.1 Zusammenfassung
Die IDS-2 ist für die Anwendung in der Diagnostik intellektueller Hochbegabungen mit Einschränkungen geeignet.
Die Normstichprobe ist gemessen am abgedeckten Altersbereich klein. Sehr hohe IQ-Werte (> IQ 130) basieren daher wahrscheinlich auf keiner ausreichenden Datengrundlage. Doch wurde für die Normierung eine Methode genutzt, die jeweils die komplette Datengrundlage nutzt, was zur Güte der Normwerte bei kleinen Stichproben beiträgt.
Das Manual enthält keine Angaben zu Itemschwierigkeiten, zu Testwerteverteilungen oder möglichen Deckeneffekten bei der Testung Hochbegabter. Die Informationen zur Beurteilung der Differenzierungsfähigkeit der IDS-2 im oberen Leistungsbereich sind daher nicht ausreichend.
Die Erstellung eines Fähigkeitsprofils ist möglich. Bei Einsatz des gesamten Verfahrens liefern die IDS-2 vielfältige Informationen zu schulisch relevanten Funktionsbereichen.
Der erreichbare Höchstwert für die Intelligenzwerte liegt bei IQ=145.
2.2 Eignung als Screening
Als Screening eingeschränkt geeignet
Nicht als Gruppentest durchführbar. Durchführungszeiten für IQ-Screening bei ca. 10 Min., aber nur zwei Subtests (Matrizenaufgaben und Kategorien nennen) und damit eingeschränkter Messbereich.
2.3 Eignung zur Profilerstellung
Fähigkeitsprofil möglich
Erstellung eines Intelligenzprofils über die Intelligenzfaktoren möglich (aufgrund höherer Reliabilität und Validität sollten hierfür die Faktoren und nicht die Untertests verwendet werden).
Zudem Erstellung eines Gesamtprofils über alle oder ausgewählte kognitive Funktionen und allgemeine Entwicklungsfunktionen möglich.
Grafische Darstellung als Profildiagramm im Ergebnisbericht.
Angabe zu kritischen Differenzen zur Profilinterpretation vorhanden. Diese weichen aber von der üblichen Berechnung mittels Fehlerwahrscheinlichkeit, Standardabweichung und Reliabilität ab und sollten daher mit diesen Größen neu berechnet werden.
2.4 Eignung für die Schullaufbahnberatung
Für Schullaufbahnberatung geeignet
Es handelt sich um einen mehrdimensionalen Test über schulisch relevante Funktionsbereiche mit Vergleichswerten für Schüler/innen nach Alter, für Funktionsbereich Schulische Kompetenzen auch nach Klassenstufen (bis 9/2).
Keine schulartspezifischen Normen.
Das Manual enthält ein Fallbeispiel im Kontext der Schullaufbahnberatung (frühzeitige Einschulung).
Es fehlen Angaben zur prognostischen Validität im Hinblick auf Schulleistungen.
2.5 Eignung für Selektionsentscheidungen
Für Selektionsentscheidungen eingeschränkt geeignet
Sehr gute Reliabilität und damit genaue Messung und relativ kleine Konfidenzintervalle.
Untersuchungen mit mathematisch talentierten und überdurchschnittlich intelligenten Kindern vorhanden, doch sind Angaben zur Differenzierungsfähigkeit im oberen Leistungsbereich nicht ausreichend (keine Angaben zu Itemschwierigkeiten und Testwertverteilungen).
3 Normierung
3.1 Vorbemerkungen
Nutzung kontinuierlicher Normierungsmethode, nach der die Rohwertverteilung pro Subtest als Funktion von Alter oder Klassenstufe geschätzt wird. Hierbei werden die Daten aller Altersgruppen genutzt, was die Genauigkeit der erstellten Normwerte erhöht.
3.2 Aktualität der Normen
Aktualität der Normen gegeben
Normierung: Juni 2015 – Mai 2017
Ein-monatsspezifische Altersnormen (Wertpunkte) für alle Subtests. Umrechnung in PR, z-Werte und T-Werte möglich. Für Intelligenzwerte und Intelligenzfaktoren auch Umrechnung in IQ-Normwerte.
Altersäquivalente für Subtestrohwerte.
Halbjahresspezifische Klassennormen (Wertpunkte) für Subtests des Funktionsbereichs Schulische Kompetenzen.
Keine Normdifferenzierung nach Land (siehe 3.3) oder Geschlecht bei kleinen Unterschieden (max. 5.8 % der Varianz der Untertestmittelwerte).
3.3 Repräsentativität der Normen
Repräsentativität der Normen nicht gegeben
n = 1.672 aus der deutschsprachigen Schweiz (n = 973), Deutschland (n = 614) und Österreich (n = 85).
Für Daten aus deutschsprachiger Schweiz und aus Deutschland: Prozentangaben zur höchsten mütterlichen Ausbildung und zum besuchten Schultyp vorhanden; Abgleich mit Länderstatistiken fehlt. Keine weiteren Angaben zur Repräsentativität (z. B. im Hinblick auf Muttersprache, Wohnort Stadt-Land, Region) oder zur Stichprobengewinnung. Einschränkungen der Repräsentativität vorhanden:
Zu kleine Gruppengröße für Österreich, um Zusammenlegung mit den Normdaten aus der Schweiz und aus Deutschland oder Nutzung der Normen für Österreich zu rechtfertigen.
Gruppengrößen pro Altersjahr insgesamt eher klein (n = 69 bis 137).
4 Objektivität
4.1 Vorbemerkungen
Keine speziellen Hinweise
4.2 Durchführungsobjektivität
Durchführungsobjektivität gegeben
Standardisierte schriftliche und mündliche Instruktionen inklusive Nachfrageregeln vorhanden.
4.3 Auswertungsobjektivität
Auswertungsobjektivität gegeben
Detaillierte Auswertungsanweisungen, Auswertungsschablonen und Protokollbögen vorhanden. Online Auswertung über Auswertungsplattform von Hogrefe: Die im Protokollbogen notierten Ergebnisse werden online in das Auswertungsprogramm eingegeben.
4.4 Interpretationsobjektivität
Interpretationsobjektivität gegeben
Normwerte und Hinweise zur Interpretation (inklusive Fallbeispiele) vorhanden, sowie weitere Tabellen zur Unterstützung der Testwertinterpretation (z. B. Standardmessfehler, Standardabweichungen, kritische Differenzen für die Profilinterpretation; 95%-Konfidenzintervalle für Intelligenzfaktoren und die Intelligenzwerte IQ und IQ-Profil).
5 Reliabilität
5.1 Vorbemerkungen
Keine speziellen Hinweise
5.2 Paralleltest-Reliabilität
Paralleltest-Reliabilität entfällt (Kein Paralleltest vorhanden)
5.3 Testhalbierungsreliabilität
Angaben zur Testhalbierungsreliabilität fehlen
5.4 Retest-Reliabilität
Retest-Reliabilität gegeben
Messwiederholung nach durchschnittlich 24 Tagen bei 69 Schweizer Kindern und Jugendlichen: Mittlere bis hohe Stabilitäten für Intelligenzfaktoren und Intelligenzwerte (.65-.89) sowie für Subtests exekutiver Funktionen (.72-.75) und sozial-emotionaler Kompetenz (.71-.85).
5.5 Interne Konsistenz
Interne Konsistenz gegeben
Gute bis sehr gute Werte für Intelligenzfaktoren und Intelligenzwerte in einzelnen Altersgruppen (.77-.97) und für die Gesamtgruppe (.91-.98).
Gute bis sehr gute Werte für Exekutive Funktionen (.88; Gesamtgruppe), Psychomotorik (.82-.87; 2 Altersgruppen), Sozial-emotionale Kompetenz (.82-.86; 2 Altersgruppen), Schulische Kompetenzen (.93-.97; 6 Altersgruppen bzw. 4 Klassenstufengruppen) und Arbeitshaltung (.90-.92; 3 Altersgruppen).
5.6 Profilreliabilität
Angaben zur Profilreliabilität fehlen
Es wird empfohlen, bei der Intelligenz-Profilerstellung aufgrund höherer Reliabilität die Intelligenzfaktoren und nicht die Subtests zu verwenden.
6 Validität
6.1 Vorbemerkungen
Weiterführende Validierungsstudien überwiegend mit Schweizer Stichproben.
6.2 Konstruktvalidität
Konstruktvalidität gegeben
Mittlere positive Zusammenhänge mit IDS als konzeptueller Grundlage.
Überwiegend niedrige bis mittlere positive Korrelationen zwischen den kognitiven und allgemeinen Entwicklungsfunktionen. Intelligenzwerte korrelieren hoch untereinander (.77-.95) und mittelhoch mit Gesamtwert Exekutive Funktionen (.47-.64).
Konfirmatorische Faktorenanalysen der Normdaten unterstützen die postulierte Intelligenzstruktur für IQ-Profil (CHC-Modell) und IQ (Ein-Faktor-Modell) (Modellfit: sehr gut); Messinvarianzprüfungen über drei Altersgruppen oder die Geschlechter stützen die Einsetzbarkeit in den verschiedenen Gruppen (partiell skalare bis vollständige Messinvarianz).
Erwartungsgemäße Zusammenhänge mit anderen Tests und Fragebögen sowie Außenkriterien (siehe 6.3).
Signifikante Unterschiede in kognitiven und allgemeinen Entwicklungsfunktionen zwischen durchschnittlich und überdurchschnittlich intelligenten oder mathematisch talentierten Kindern (mittlere bis große Effekte) bzw. Kindern mit Intelligenzminderung (große bis sehr große Effekte). Keine Unterschiede zwischen Kindern mit AD(H)S mit Medikation und nach Alter, Geschlecht und mütterlicher Ausbildung parallelisierter Kontrollgruppe. Erwartungsgemäße Unterschiede in Einzelskalen und/oder Gesamttest beim Vergleich mit motorisch auffälligen Kindern oder Kindern mit Autismus-Spektrum-Störung. Nicht-erwartungsgemäß mittlere bis große Unterschiede in allen Skalen (außer Psychomotorik) für Jugendliche mit LRS, aber größte Effekte für Lesen und Rechtschreiben.
6.3 Kriteriumsvalidität
Kriteriumsvalidität gegeben
Zusammenhänge mit anderen Tests und Fragebögen (Auswahl)
WISC-IV (Petermann & Petermann, 2011): n = 114, mittlere Korrelationen von WISC-Gesamtwert mit Intelligenzwerten und Schulischen Kompetenzen (.52-.69) und mit Exekutive Funktionen (.47); mittlere Korrelationen der WISC-Indizes mit den entsprechenden Intelligenzfaktoren (.43-.71).
RIAS (Hagmann-von Arx & Grob, 2014): n = 180, mittlere Korrelationen von RIAS-Gesamtwert mit Intelligenzwerten und Schulischen Kompetenzen (.47-.55).
SON-R 6-40 (Tellegen et al., 2012): n = 139, mittlere Korrelationen von SON-Gesamtwert mit Intelligenzwerten und Schulischen Kompetenzen (.43.-.67).
Maße der Aufmerksamkeit und Exekutive Funktionen:
n = 38, erwartungsgemäße mittlere Korrelationen mit TMT (Reitan, 1992; -.31/-.36), kleine bis mittlere mit TEA-Ch (Horn & Jäger, 2008; z.B. selektive Aufmerksamkeit: -.31).
M-ABC-2 (Petermann, 2015): n = 54, mittlere Korrelationen von M-ABC-2-Gesamtwert und Psychomotorik (.49).
ISK-K (Kanning, 2009): n = 182, kleine Korrelation von ISK-K-Gesamtwert mit Sozial-emotionale Kompetenz (.17).
Persönlichkeitsmaße:
mittlere Korrelationen von Arbeitshaltung mit Elterneinschätzung der Gewissenhaftigkeit mittels FFFK (Asendorpf, 1998; n = 785, r = .28), Selbsteinschätzung der Gewissenhaftigkeit mittels NEO-PI-R (Ostendorf & Angleitner, 2004; n = 185, r = .61) und verschiedenen Fragebögen zur Erfassung der Leistungsmotivation (.51-.65; n zwischen 184 bis 358).
Zusammenhänge mit Schulleistungen
Elterneinschätzungen: n = 294-728, Normierungsstichprobe; kleine bis mittlere Korrelationen von Einschätzungen in einzelnen Fächern mit IQ und IQ-Profil (.23-.41) und mit Schulische Kompetenzen (.27-.43).
Noten: n = 194-478, Normierungsstichprobe; kleine bis mittlere Korrelationen von fachspezifischen Noten mit IQ und IQ-Profil (.17-.35), mit Schulische Kompetenzen (.16-.41) und mit Arbeitshaltung (.16-.23).
Lese- und Rechtschreibtests: n = 60, erwartungskonforme mittlere bis hohe Zusammenhänge der IDS-2-Subtests Lesen und Rechtschreiben mit verschiedenen sprachlichen Kompetenzen erfasst mittels DEUTSCH 9-10 (Segerer et al., in Vorb.; r zwischen .23-.73) und R-FIT 9-10 (Lenhart et al., in Vorb.; r zwischen .34-.76).
6.4 Prognostische Validität
Angaben zur prognostischen Validität fehlen
7 Ökonomie
7.1 Vorbemerkungen
Keine speziellen Hinweise
7.2 Durchführungsökonomie
Durchführung ökonomisch
Modulare Durchführung möglich.
Dauer der Gesamttestung 3 bis 4 Stunden.
Dauer bei modularer Durchführung: IQ-Screening ca. 10 Min, IQ ca. 50 Min., IQ-Profil ca. 90 Min., Exekutive Funktionen ca. 30 Min., Psychomotorik ca. 20 Min., Sozial-emotionale Kompetenz ca. 15 Min., Schulische Kompetenzen je nach Alter 30-60 Min., Arbeitshaltung ca. 7 Min. (Angaben nach Manual)
7.3 Auswertungsökonomie
Auswertung ökonomisch
Elektronische Auswertung im Hogrefe Testsystem 5. Die im Protokollbogen notierten Ergebnisse werden online in das Auswertungsprogramm eingegeben. Ein Ergebnisbericht kann heruntergeladen werden.
8 Weiterführendes
8.1 Vorgängerversion
Grob, A., Meyer, C. S. & Hagmann-von Arx, P. (2009). IDS. Intelligence and Development Scales. Intelligenz- und Entwicklungsskalen für Kinder von 5-10 Jahren. Bern: Huber.
8.2 Literaturangaben
Asendorpf, J. B. (1998). FFFK - Fünf-Faktoren-Fragebogen für Kinder. Berlin: Humboldt-Universität, Institut für Psychologie.
Hagmann-von Arx, P. & Grob. A (2014). RIAS. Reynolds Intellectual Assessment Scales and Screening. Deutschsprachige Adaptation der Reynolds Intellectual Assessment Scales (RIAS™) & des Reynolds Intellectual Screening Test (RIST™) von C. R. Reynolds und R. W. Kamphaus. Bern: Hans Huber.
Horn, R. & Jäger, R. (2008). TEA-Ch. The Test of Everyday Attention for Children. Deutsche Bearbeitung und Normierung des Test of Everyday Attention for Children von T. Manly, I. H. Robertson, V. Anderson und I. Nimmo-Smith, I. (2., korr. Aufl.). Frankfurt a. M.: Pearson.
Kanning, U. (2009). ISK-K. Inventar sozialer Kompetenzen. Göttingen: Hogrefe.
Lenhart, J., Segerer, R., Marx, P. & Schneider, W. (in Vorb). R-FIT 9-10. Fehleridentifikationstest – Rechtschreibung für neunte und zehnte Klassen. Göttingen: Hogrefe.
McGrew, K. S. (2005). The Cattell–Horn–Carroll theory of cognitive abilities. In D. P. Flanagan & P. L. Harrison (Hrsg.), Contemporary intellectual assessment: Theories, tests, and issues (2. Aufl.) (pp. 136−181). New York, NY: Guilford Press.
Ostendorf, F. & Angleitner, A. (2004). NEO-PI-R. NEO-Persönlichkeitsinventar nach Costa und McCrae, Revidierte Fassung. Göttingen: Hogrefe.
Petermann, F. (Hrsg.) (2015). M-ABC-2. Movement Assessment Battery for Children – Second Edition (4., überarb. u. erw. Aufl.). Frankfurt a. M.: Pearson.
Petermann, F. & Petermann, U. (Hrsg.) (2011). Wechsler Intelligence Scale for Children - Fourth Edition. Manual 1: Grundlagen, Testauswertung und Interpretation. Übersetzung und Adaptation der WISC-IV von David Wechsler. Frankfurt a. M.: Pearson.
Reitan, R. M. (Ed.) (1992). TMT. Trail Making Test. Tucson, AZ: Reitan Neuropsychology Laboratory.
Segerer, R., Lenhart, J., Marx, P. & Schneider, W. (in Vorb). DEUTSCH 9-10. Deutscher Sprachtest für neunte und zehnte Klassen. Göttingen: Hogrefe.
Tellegen, P. J., Laros, J. A. & Petermann, F. (2012). SON-R 6-40. Non-verbaler Intelligenztest. Göttingen: Hogrefe.
