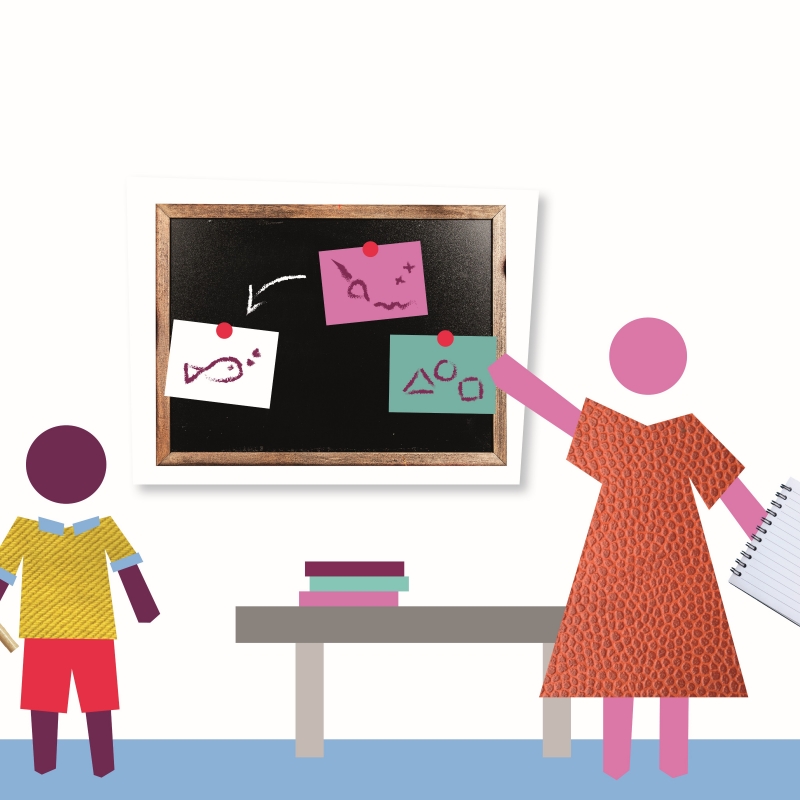Hochbegabte unterstützen
Dabei lassen sich zwei Paradigmen nennen, die sich von damals bis heute nicht geändert haben: Lernen ist ein individueller Vorgang und muss durch das Kind immer selbst bewältigt werden. Und: Es gibt unterschiedliche lebensweltliche Quellen des Lernens. Ein drittes Paradigma kommt auf der Metaebene daher: Dieser Beitrag verwendet „alte“ Texte über das Lernen – und will genau dadurch klar machen, dass dort eine Menge kluger und vor allem tiefgehender Überlegungen versammelt sind, die es allesamt wert sind, auch in den Zeiten neurobiologischer Lerndiskurse wahrgenommen zu werden.
Worum soll es gehen?
Der Lernbegriff hat sich über die Jahrhunderte – und mit dem Einfluss der Psychologie erst recht ab den 1920er-Jahren – verändert, verfeinert und ausdifferenziert. Historisch gesehen organisieren und systematisieren Gesellschaften Lernen jeweils nach unterschiedlichen Vorstellungen: Welche (und wessen) Interessen und Wertvorstellungen haben Priorität, und welche sozioökonomischen Entwicklungen werden verfolgt und dann daraus abgeleitet 1?
Lernen wird aktuell als aktiver und konstruktiver Prozess des Individuums definiert. Lernen geschieht also absichtsvoll, nebenbei (implizit) und reflexiv. Was etwas akademisch klingt bedeutet, dass jede:r Heranwachsende:r stets „selbst“ lernen muss – diesen Prozess kann ihm bzw. ihr niemand abnehmen. Belohnt werden die Lernenden aber durch eigene Konstruktionen, wenn z. B. vorhandene und neu hinzukommende Wissensbestandteile miteinander verknüpft werden 2, 3.
Ähnlich wie beim Begabungsbegriff gilt: Universalistische (allumfassende) Definitionen für das Lernen gibt es nicht. Mannigfaltige Lehrsätze unterstreichen bestimmte Merkmale und vernachlässigen andere. Auch hier wiederum findet man das gleiche Vorgehen wie bei den Modellen der (Hoch-)Begabung.
Der Beitrag möchte dafür werben, auf ältere Konturen des Lernens zu blicken – nicht aus einer verklärenden Perspektive, sondern mit dem Ziel einer aktuellen Vergewisserung. Parallel sollen die bekannten Förderprinzipien (nicht nur für Begabte) in diesem Kontext gewichtet werden.
Der Blick zurück – Urformen des Lernens im Jena-Plan
Die Jenaplan-Schule 4 wurde maßgeblich von Peter Petersen (1884-1952) entwickelt. Dieser gilt als Reformpädagoge, der sich seinerzeit sehr nahe an die nationalsozialistische Ideologie band. Daher überwog in der letzten Zeit eine kritische Rezeption seiner Person (bis hin zu Umbenennungen von Schulen). Der Jena-Plan wurde davon allerdings ausgenommen.
Petersen entwickelte vier Urformen des Lernens und Sich-Bildens. Damit wurde der Konstruktion von kindlichen Lebenswelten (Institution, Familie, Medien, Peers) gegenüber der traditionellen Perspektive linearer Wissensvermittlung Vorrang eingeräumt.
Was entwickelten Peter Petersen und sein Team in einer Reformschule im thüringischen Jena in den 1920er-Jahren? Die vier Lernformen sind weitgehend bekannt und verblüffen dennoch partiell: a. Gespräch, b. Spiel, c. Arbeit und d. Feier. Schauen wir einmal kurz auf die inhaltlichen Dimensionen.
a. Gespräch
Das Gespräch als Interaktion klärt im besten Fall die Sachen und stärkt die Menschen, wurde einmal von Hartmut von Hentig postuliert 5.
Hartmut von Hentig ist im Zusammenhang mit den Geschehnissen an der Odenwaldschule heftiger Kritik ausgesetzt, seine Gedanken zum Gespräch stellen jedoch nach wie vor eine wichtige Theorie für das pädagogische Arbeiten dar.
Das Gespräch ist ein (Haupt-)Teil von Kommunikation, welche das „Medium der Manifestation menschlicher Beziehungen“ darstellt. Im Gespräch werden Wirklichkeiten abgeglichen und, wenn es gut kommt, auch Wahrheiten verhandelt. Wenn Kommunikation (im Gespräch) „alle aus dem menschlichen Verhalten hervorgehenden (erweiterten) Mitteilungen“ darstellt, wie es einst Paul Watzlawick 6 formulierte, bedeutet dies nichts anderes als zum Beispiel miteinander zu reden oder nicht miteinander zu reden oder übereinander zu reden und sogar Informationen zurückzuhalten. All diese sind unschätzbare Lerndomänen, nicht nur für begabte Heranwachsende. Es bilden sich nämlich durch Übung Kommunikationsstrukturen, die nicht nur für alle Beteiligten bedeutsam sind, sondern auch in der Umwelt Struktur und Sicherheit geben können.
Lernfelder sind hier zum Beispiel die Akzeptanz unterschiedlichster Formen, Gespräche zu führen bzw. zu gestalten. Viel oder wenig zu reden, inhaltliche Tiefe oder Themenhopping sowie das Erlernen der Dialektik von Eingreifen und Zurückhaltung im Gesprächsfluss ist nicht nur für Begabte ein Muss. Das Ziel des Gesprächs ist es, Kollusionen aufzubauen – das sind akzeptable kommunikatorische Beziehungsmuster.
b. Spiel
Das Spiel ist dem Gespräch gar nicht so fern – in nahezu 80 Prozent der spielerischen Aktivitäten wird gesprochen, in jedem Spiel wird kommuniziert – getreu dem ersten Axiom des bereits oben genannten Paul Watzlawick: man kann nicht nicht kommunizieren. Was aber macht das Spiel zum Lernfeld? Spiel wird nicht selten als ein „Urphänomen des Lebens“ betrachtet. Und wenn Schulen sich nicht als isolierte Lernlaboratorien betrachten, sondern dem Leben und den Phänomenen nachspüren, so scheint es fast zwangsläufig, dem Spiel – an sich und zur Verdeutlichung von Lernsequenzen – Raum und Zeit zu geben. Man könnte sich nun fragen: Spielen in der Schule? Dort wird doch gelernt! Andere werden sich an das Unterrichtsfach „Darstellendes Spiel“ erinnern, wieder andere an das Eckenraten, was die Mathematiklehrerin meist als Spiel ankündigte und doch letztlich nur als die Einkleidung von Aufgaben in ein scheinbar spielerisches Gewand zeigte.
Sich „spielerisch“ Neues anzueignen, Automatismen auszubilden, Versuch und Irrtum ohne Konsequenzen auszutesten und intelligent zu üben, kann genau dies bedeuten. Wenn man sich einmal die Mühe macht und die Bildungsempfehlungen und -pläne der Bundesländer durchmustert wird staunen, wie oft Spiel in diesen Kontexten exklusiv benannt wird: Unterrichtsmethoden und -inhalte, die z. B. eine symbolische Vermittlung der Wirklichkeit der Welt in sich tragen unter dem Aspekt, mit und durch Spiel, Darstellung, Bewegung, bildnerisches Gestalten usw. den Schüler:innen ein möglichst breites Spektrum an Symbolisierungsformen anzubieten. Und in diesem Zusammenhang ist es den Subjekten der (Spiel-)Handlungen völlig gleich, ob sie ein Spiel, eine Übung, eine Session, ein Experiment oder die Probe aufs Exempel vollziehen. Begabten wird damit die Möglichkeit zu unkonventionellen Lösungen ebenso eröffnet wie kreative (divergente) Wege dorthin. Letztlich gilt die Albert Einstein (hochbegabt) zugeschriebene Sentenz, dass nur jener (und mutmaßlich jene), die mit einem Gedanken spielen kann, die Thematik auch verstanden habe.
Spiel wird – das sei der Fairness halber hinzugefügt – in der Pädagogik auch partiell kritisch gesehen. Erinnert sei an Maria Montessori. Aber jener Maria Montessori verdanken wir die kluge Analyse kindlichen Lernens, die den nächsten Abschnitt beherrschende kindliche Arbeit.
c. Arbeit
Die Arbeit an verschiedenen Lerngegenständen – Maria Montessori nannte es treffend „Material“ – fasst mindestens drei für das individuelle Lernen wesentliche Ebenen:
Erstens wirkt jene Arbeit der Form schulischer Wissensvermittlung (ebenso grob wie falsch skizziert: Lehrperson weiß alles – Schüler:innen wissen wenig, wollen aber alles wissen) entgegen.
Zweitens sah Montessori durch die Altersmischung in den Gruppen (wie sie auch in der Jena-Plan-Schule die Regel war) einen hohen Vorteil von Beratung, Austausch und Hilfe unter den Schüler:innen 7 – aktuelles Stichwort kooperatives Lernen. Sie ging davon aus, dass viel Lernen durch Nachahmung entsteht. Sie notierte selbst: Es findet eine Art Austausch statt, und daher eine ursprüngliche Bewegung, die nicht zweitrangig, sondern fundamental ist und aus der das soziale Miteinander hervorgeht. Sie ging weiterhin davon aus, dass Kinder gerne von sich aus arbeiten und an ihren Wissenstand anknüpfen wollen – genau dort, wo Psycholog:innen später die „Zone der nächsten Entwicklung“ verorten. Wichtig erscheint sowohl, dass alle Kinder individuell aber auch zusammenarbeiten. Das entspricht genau dem aktuellen Paradigma, dass das Lernen als individueller Vorgang im sozialen Vollzug zu begreifen ist.
Drittens kommt es durch die „Polarisation der Aufmerksamkeit“ (Montessori) zu einem Zustand der entspannten Wachheit, wie es der Psychologe André Zimpel 8 nennt. Dieser Zustand könne bei jüngeren Kindern nur über die Handlungsebene erzeugt werden, Erwachsene hingegen könnten diesen Zustand sogar über die Fähigkeit, mentale Bilder zu erzeugen, erreichen.
d. Feier
Die Feier schließlich schließt wiederum den Lernkreis hin zu den sozialen Kompetenzen. Die Vorbereitungen, Aufführungen (die geprobt, einstudiert und „gelernt“ werden müssen) bis hin zum ausgelassenen Sich-gehen-Lassen bilden jene Lernebenen ab, die oftmals als stimulusbasiert und konzeptbildend bezeichnet werden. Über allen vier Domänen thront das implizite und Beobachtungslernen, flankiert von der Ausbildung von Präferenzen und der Übung im Auswählen.
Aber all dies ist kaum etwas wert, wenn nicht im Zentrum aller Angebote der Lerner bzw. die Lernerin steht – die im Idealfall das eigene Lernen selbst zu regulieren vermag. Auch das Lernen muss also gelernt werden.
Was ist Selbstreguliertes Lernen? Eine recht alte, aber immer noch aktuelle psychologisch konturierte Bestimmung haben Schiefele und Pekrun 9 Mitte der 1990er-Jahre entwickelt. Danach ist es eine Form des Lernens, bei der die Person in Abbildung von der Art ihrer Lernmotivation selbstbestimmt eine oder mehrere Steuerungsmaßnahmen ergreift und den Fortgang des Lernprozesses selbst überwacht. Es ist noch komplizierter: Neben diesen metakognitiven Prozessen (Planen, Überwachen, Bewerten) spielen zugleich Motivation und volitionale Prozesse (in Richtung stärkerer Selbstwirksamkeit, Interesse, Ausdauer, Eigenständigkeit, erhöhter Anstrengungsbereitschaft) wichtige Rollen.
Haben institutionale Förderprinzipien etwas mit Lernen zu tun?
Kommen wir nun zum zweiten Schwerpunkt – wie lassen sich bekannte Förderprinzipien (nicht nur für Begabte) in diesem Kontext gewichten?
Grundidee dabei ist, aufzuzeigen, was sich in unserer Vorstellung, was Lernen ist, verändert hat – dies vor dem Hintergrund, dass sich auch Begabungsmodelle im Lauf der Zeit weiterentwickelt haben. Letztere müssten hier nicht direkt abgebildet werden, anhand von Beispielen aus den Begabungsmodellen zeigt sich, wie sich die Auffassung von Lernen über die Zeit verändert hat.
Eine Reihe von Förderprinzipien wird in der Praxis erfolg- und variantenreich angewendet. Meist handelt es sich um Akzeleration (beschleunigtes Lernen), Enrichment (vertieftes Lernen), Compacting (Auslassen von Lernfeldern zugunsten anderer) und Grouping (Gruppierung Begabungsähnlicher z. B. in Kursen). Die meist institutionelle Angebotspalette wird durch Mischformen zusätzlich verbreitert. Nicht selten wird auch Empowerment (Stärkung von Autonomie und Selbstverfügung) hinzugerechnet.
All diese Förderprinzipien haben viel mit Lernen zu tun – und zwar mit alten und neuen Formen. Beim zuletzt erwähnten Empowerment lernen Begabte (im besten Falle) ihre eigenen (vielfach durch biografische Extremsituationen verschütteten) personalen und sozialen Ressourcen (wieder) zu entdecken, ihre Fähigkeiten zur Partizipation zu nutzen, nicht selten, um Kontrolle über die Gestaltung der eigenen Lebenswelten erneut zu fassen.
Compacting erfordert Mut und Zutrauen zum Lerner ebenso wie Akzeleration – beide Formen manifestieren sich nur, wenn das Umfeld akzeptiert, dass die Heranwachsenden selbst ihre Lern- und Arbeitsstrategien zu entwickeln vermögen.
Schulisches Umfeld
Und das Umfeld – die Schule? Gut durchdachte Differenzierungsprozesse in jedwedem Unterricht haben bereits elementare Enrichmentfunktion. Wenn die Schüler:innen im Gespräch ein Thema erörtern oder über etwas Geschehenes reden (Metakommunikation) oder die Arbeitsaufträge sinnstiftend und herausfordernd sind, neue Denkhorizonte ins Spiel kommen und Erfolge geFeiert werden (etwa in gelungenen Präsentationen) vertiefen sich inhaltliche Erkenntnisse mit dem (guten) Gefühl der Selbstwirksamkeit.
Organisatorische Möglichkeiten bieten sich in jeder Unterrichtsstunde „im Kleinen“ an. Auch bestimmte Unterrichtskonzepte beinhalten Elemente des Enrichments, so die Projektmethode bzw. handlungs- und produktionsorientierte Unterrichtsmethoden generell. Ausgefallene Fragestellungen, seltene Themen, (scheinbar) absurde Problemstellungen oder komplexe Ableitungen von Kausalbeziehungen sind entwicklungsfördernd.
In letzter Konsequenz heißt dies für Kita, Schule und Universität, Bildung bzw. Unterricht neu zu denken: Ohne Zeitkorridore, Arbeit in einer Kontur der democratic school, partielle Aufhebung der Stundentafeln, projektorientiertes Arbeiten, Zeit für Erprobung, Extra-Angebote, Vertiefungen, Nebenwege, Philosophieren als Unterrichtsprinzip, Hermeneutik u.v.m.
Schulentwicklung als Schlüssel?
Walburga Weilguny und Silvia Friedl 10 formulieren 2012 im Kontext der Begabungsentwicklung aus Schulentwicklungssicht acht Aspekte, die für eine Realisierung guten Lernens im schulischen Kontext wichtig sind und deren Bedeutung für Förderung (nicht nur) von leistungsstarken und potenziell leistungsstarken Schüler:innen überprüft werden sollten. Diese sind folgende:
- Begabungs- und exzellenzfördernde Schulkultur. Dazu muss Lernen freudvoll konnotiert und als individuell und somit hochgradig heterogen akzeptiert werden, inklusive des Weglassens von Zwischenrechnungen oder der Konzeptarbeit.
- Interne Koordination der Begabungs- und Exzellenzförderung. Mitunter hilft schon die Verankerung eines im Kollegium der Bildungseinrichtung akzeptierten Begriffs von Begabung, an dem alle weiteren Aspekte andocken (Schulcurriculum, Förderangebote, Lern- und Leistungsvereinbarungen etc.).
- Förderdiagnostik und Beratung bzw. Begleitung. Dieser Bereich wurde hier ausgeklammert. Gerade Lernberatung unter ressourcenperspektivischem Blickwinkel sei hier aber als zusätzlich relevant erwähnt.
- Förderung der Schüler:innen. Wie zuvor bereits beschrieben.
- Förderorientierte Leistungsrückmeldung. Die Grundfrage hierbei ist: Was hat die/der Schüler:in im Gespräch bzw. der Arbeit geleistet (nicht gelernt!)? Was gelang spielerisch, wo darf gefeiert werden (etwa, weil ein Denkproblem gelöst wurde)?
- Kompetenz- und Qualitätsentwicklung im Lehrer:innenkollegium. Hier geht es wieder um die Basis der Zusammenarbeit im Kollegium – ebenfalls ein Lernprozess zwischen Gespräch, Arbeit und Feier. Und ja, auch durch Spiel: jedes didaktische Angebot ist ein spielerischer Akt mit unerwartetem Ausgang. Eine Schülerfrage kann das Konzept der Stunde sprengen (von sogenannten Unterrichtsstörungen gar nicht zu reden). Sehe ich als Lehrperson diese Frage als förderlich, nützlich und hilfreich an?
- Qualitätssicherung. In hervorragenden Schulen lassen sich Lehrpersonen permanent Feedback durch die Schülerschaft geben. Die Erträge zeigen, dass dies sehr fair und konstruktiv ist.
- Synergien durch Kooperation. Enrichment ist auch an außerschulischen Lernorten zu finden. Expert:innen kommen in die Schule, mehrere Bildungseinrichtungen arbeiten zusammen, Exzellenzkurse finden an einer bestimmten Schule statt ...
Diese hier schulisch determinierte Struktur ist sowohl für den Elementarbereich als auch hinsichtlich der außerunterrichtlichen und außerschulischen Förderbereiche übertragbar.
Zwei Dinge scheinen aber unabdingbar – die Vielfalt von Lernstrategien zu achten (nachdem wir sie erkannt haben) und für jene notwendige und hinreichende Lernangebote anzubieten. Hier verbünden sich altes und neues Lernen, die metakognitiven Strategien z. B. der Planung, Überwachung, Regulation und der (Selbst-)Bewertung des eigenen Lernprozesses, die im Feedback mit den Lehr-Lernangeboten dorthin führen, wo jene Zone der nächsten Entwicklung ist, die Lev Vygotskij das „Gebiet der noch nicht ausgereiften, jedoch reifenden Prozesse“ nennt 11. Dorthin sollte Entwicklung damals und wird Entwicklung auch zukünftig ihren Weg nehmen.